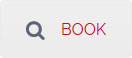Robben, Holländer, Walfang…
Das Jahr 1767 bedeutet auf Sylt kurz und knapp: Sylt ist ohne: ohne Hindenburgdamm. Ohne Droschke, ohne Auto. Ohne Luxus. Keine Heizungen, nur Torf. Keine Straßen. Keine Inselbahn. Die Insel und ihre Bewohner sind Wind und Wetter ausgesetzt. Die Wirtschaftszweige – das Wort ist maßlos übertrieben – heißen: Fischfang, Robbenjagd, Torfgewinnung, Seefahrt. Ein Drittel der Sylter fährt jedes Jahr Monate lang zur See – zum Walfang auf niederländischen Seglern. Walfang mit einem Segler, das bedeutet: permanente Lebensgefahr in arktischen Gewässern. Nicht jeder kommt zurück. Aber: Die Holländer bringen ein wenig Wohlstand auf die Insel: Delfter Kacheln, mit denen die Wände der Häuser innen belegt werden. Das isoliert gegen Kälte. Und schließlich: Vogelkojen.
Seit dem 16. Jahrhundert in Holland üblich und sehr verbreitet, genehmigt der dänische König Christian VII am 20. Oktober 1767 den ersten Sylter Entenfang. Von da an werden jährlich, die Zahlen sind nicht hundertprozentig gesichert, zwischen 8.500 und 25.000 Wildenten gefangen. Krick-, Pfeifen-, Stockenten und andere. In trockenen Jahren sind es mehr, denn dann finden die Vögel auf ihrem Flug in den Süden weniger Süßwasser und steuern vermehrt die Koje an. Hundert Jahre später, mit Beginn gesicherter Volkszählungen, sollten auf Sylt gerade einmal 2.870 Menschen leben. Ein Drittel wie erwähnt lange auf See.
Für den Rest blieben bis zu 25.000 Wildenten. Nicht nur eine Delikatesse, die haltbar gemacht werden kann. Zum Beispiel durch Pökeln, für den Winter. Auch ein Naturprodukt, das scheinbar im Überfluss vorhanden ist – und von dem alles verwendet wird. Die Frauen bekommen die Federn. Heute benötigt man für ein qualitativ hochwertiges Federbett aus Entenhalbdaune bis zu anderthalb Kilogramm Federn/Daunen.
Das Gefieder einer einzigen Ente oder Gans, so leicht es im Kissen wirkt, bringt schon mal 300 Gramm auf die Waage. Manch eine Ente wurde auch auf’s Festland verkauft. Übrigens: Enten unterlagen dem Jagdrecht, schon damals. Der König berechnete für die Konzession zum Betrieb der Vogelkoje zehn Reichstaler. Das reichte beispielsweise einer vierköpfigen Familie ein Jahr lang für’s Wohnen. Je Erfolg- und ertragreicher der Kampener Entenfang wurde, desto höher wurde die Konzessionsabgabe.
Süß und gefährlich
Aber wie funktioniert so etwas? Nun, die Technik einer Vogelkoje ist einfach und effizient. In Kampen hat der quadratische See die Seitenlänge einer durchschnittlichen Flughafen-Landebahnbreite, sagen wir einmal des Münchener Flughafens, also 60 Meter. (Zum Vergleich: Die Westerländer Landebahnen sind nur 45 Meter breit.) Enten starten und schwimmen wie beispielsweise auch Flugboote am liebsten gegen den Wind. Deshalb legte man vier Fangkanäle, auch Fangpfeifen genannt, an den Ecken des Sees in die Hauptwindrichtungen, aus denen es auf Sylt weht: West, Nordwest, Nordost und Südwest.
Die Fangkanäle wurden, ähnlich einer Reuse, mit Netzen überzogen, die immer schmaler wurden. Schilfwände an den Seiten verbargen die Kojenwärter, die die Enten fingen. Mit Lockenten, das waren Wildenten, denen die Flügel gestutzt worden waren, verführte man zur Landung auf dem (für sie nach anstrengendem Flug über die salzige See) verlockenden Süßwasserteich. Die Lockenten waren an Gerstenfutter gewöhnt worden; wurden sie hungrig, schwammen sie in die Fangkanäle, an deren Ende ihr Futter wartete; Wildenten folgten nichtsahnend.
Auf dem Weg zu ihren Ställen pickten die Lockenten bereits rechts und links am Ufer ausgelegte Gerste, eine frühe Form der Anfütterung. Die Wildenten wurden gleichzeitig vom Kojenwärter hinter der Schilfwand mehr und mehr in die Enge getrieben. Der Lärm ließ sie hochfliegen, doch die Reuse kannte kein Entkommen nach oben. Von hinten drängten Artgenossen nach, von dort trieb aber auch der Kojenwärter. Kurz vor der Schmalstelle der Fangpfeife bogen die Lockenten in die Stallungen zu ihrer Gerste ab; das Ende für die Fügel kam am Ende der Reuse; es kam schmerzlos schnell.